
Der Sprung zu 20 % Mehrumsatz gelingt nicht durch den Kauf neuer Technologien, sondern durch die strategische Monetarisierung Ihrer bereits vorhandenen Daten-Assets.
- Konzentrieren Sie sich auf die Umwandlung von Prozessdaten in kundenorientierte Digitalprodukte, anstatt nur interne Effizienz zu steigern.
- Setzen Sie auf eine wellenbasierte Einführung, die mit schnellen, sichtbaren Erfolgen Vertrauen schafft, statt auf einen riskanten „Big Bang“.
- Befähigen Sie Ihre Mitarbeiter durch gezielte Qualifizierung und machen Sie Daten zu einem „Erfahrungs-Verstärker“, nicht zum Gegner der Intuition.
Recommandation: Beginnen Sie mit der Identifizierung des einen Datenprodukts mit dem höchsten Geschäftspotenzial und der besten Datenverfügbarkeit, um einen schnellen ersten Erfolg zu garantieren.
Viele Geschäftsführer und Chief Digital Officers kennen das Gefühl: Es werden Millionen in die IT-Infrastruktur, Cloud-Migration und neue Software investiert, doch der erhoffte Umsatzsprung bleibt aus. Die digitale Transformation erschöpft sich oft in der Optimierung interner Prozesse – ein notwendiger, aber selten wertschöpfender Schritt. Man jagt Buzzwords wie „Big Data“ und „KI“, ohne eine klare Strategie zur Monetarisierung zu haben. Das Resultat sind effizientere Abläufe, die Kosten senken, aber keine neuen Erlösströme schaffen. Die wahren Schätze – die in diesen Prozessen generierten Daten – bleiben ungenutzt in Silos liegen.
Das Kernproblem liegt in einer falschen Perspektive. Statt Digitalisierung als reines Effizienzprojekt zu betrachten, muss sie als Motor für neue Geschäftsmodelle verstanden werden. Die entscheidende Frage ist nicht: „Wie können wir unsere Prozesse digitalisieren?“, sondern: „Welche neuen Produkte und Dienstleistungen können wir aus den dabei entstehenden Daten entwickeln?“. Genau hier setzt der strategische Hebel für signifikantes Wachstum an. Es geht um einen fundamentalen Wertschöpfungs-Pivot: weg vom alleinigen Fokus auf das physische Produkt, hin zu datenbasierten Services, die echten Mehrwert für den Kunden schaffen.
Doch wie gelingt dieser Wandel in der Praxis, ohne die Organisation zu überfordern oder in technologiegetriebenen Sackgassen zu landen? Der Schlüssel liegt in einem strategischen, umsatzfokussierten Vorgehen, das Technologie, Organisation und Kultur miteinander verbindet. Dieser Leitfaden zeigt Ihnen, wie Sie die typischen Fallstricke vermeiden, eine Kultur der Datenwertschätzung etablieren und Ihre vorhandenen Daten-Assets gezielt in Produkte umwandeln, die bis zu 20 % zusätzlichen Umsatz generieren können.
Um diese Transformation erfolgreich zu gestalten, ist ein strukturierter Ansatz unerlässlich. Wir beleuchten die entscheidenden strategischen Bausteine, von der Priorisierung Ihrer Initiativen bis zur Neudefinition Ihres Wertversprechens.
Inhaltsverzeichnis: Ihr strategischer Leitfaden zur Daten-Monetarisierung
- Warum IT-Investitionen verpuffen, wenn Sie nur Prozesse digitalisieren statt Geschäfte?
- Wie Sie Digitalisierung in priorisierten Wellen umsetzen statt im Big Bang?
- Vollständige Cloud-Migration oder hybride Infrastruktur: was für Ihr Unternehmen passt?
- Der Technologie-Rollout, der Mitarbeiter zurücklässt und dadurch wertlos bleibt
- Wann der Kipppunkt erreicht ist, an dem Modernisierung günstiger ist als Weiterbetrieb?
- Wie Sie eine digitale Business Unit gründen, ohne Ihre Organisation zu spalten?
- Wie Sie Mitarbeiter von Datenanalyse überzeugen, die seit 20 Jahren auf Erfahrung setzen?
- Wie Sie Wert neu definieren, wenn Ihr physisches Produkt austauschbar wird
Warum IT-Investitionen verpuffen, wenn Sie nur Prozesse digitalisieren statt Geschäfte?
Der häufigste Fehler bei der digitalen Transformation ist die Verwechslung von Mittel und Zweck. Die reine Digitalisierung von Prozessen zielt auf Kostensenkung und Effizienzsteigerung ab – ein klassisches Optimierungsprojekt mit endlichem Horizont. Die Digitalisierung des Geschäftsmodells hingegen zielt auf die Schaffung neuer, nachhaltiger Erlösströme. Hier liegt der Unterschied zwischen einer Investition, die sich amortisiert, und einer Investition, die exponentielles Wachstum ermöglicht. Während erstere den Status quo sichert, sichert letztere die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens.
Das Beispiel der Seuster KG aus Lüdenscheid illustriert diesen Wandel perfekt. Statt weiterhin nur Schnelllauftore zu verkaufen, transformierte das Unternehmen sein Geschäftsmodell hin zu datengetriebenen Services. Mit „Smart Control“ bietet Seuster nun technische Überwachung und vorausschauende Wartung als Dienstleistung an. Die aus den Toren gewonnenen Daten werden nicht nur zur Prozessoptimierung genutzt, sondern sind die Grundlage eines neuen, umsatzgenerierenden Produkts. Dieser strategische Schwenk von Hardware zu Service zeigt, wie Daten-Asset-Monetarisierung in der Praxis funktioniert.
Die folgende Tabelle verdeutlicht den fundamentalen Unterschied in der Ausrichtung und den Erfolgsmetriken beider Ansätze, basierend auf einer Analyse der Erfolgsfaktoren im Mittelstand.
| KPI-Kategorie | Prozessdigitalisierung | Geschäftsdigitalisierung |
|---|---|---|
| Fokus | On-Time-On-Budget | Customer Lifetime Value durch digitale Services |
| Erfolgsmetrik | Systemimplementierung | Anteil Umsatz durch Datenprodukte |
| Zeithorizont | Projektabschluss | Nachhaltiges Wachstum |
| Wertschöpfung | Kostensenkung | Neue Erlösströme |
Die Fokussierung auf datengetriebene Geschäftsmodelle ist kein Nischenthema mehr. Eine BDI-Studie bestätigt, dass bereits 17 % der Unternehmen mit datenbasiertem Geschäftsmodell ausschliesslich datengetriebene Umsätze generieren. Diese Vorreiter haben verstanden, dass der wahre Wert nicht in der digitalisierten Maschine, sondern im digitalisierten Geschäft liegt.
Letztendlich entscheidet dieser strategische Fokus darüber, ob Ihre IT-Investitionen zu einer reinen Kostenstelle oder zum wichtigsten Wachstumstreiber Ihres Unternehmens werden.
Wie Sie Digitalisierung in priorisierten Wellen umsetzen statt im Big Bang?
Der Versuch, die gesamte Organisation auf einmal zu transformieren, ist oft zum Scheitern verurteilt. Ein „Big Bang“-Ansatz ist nicht nur kapitalintensiv und riskant, sondern erzeugt auch massiven Widerstand in der Belegschaft. Ein weitaus erfolgreicherer Ansatz ist die Umsetzung in priorisierten Wellen. Dabei werden Projekte identifiziert, die schnell einen messbaren Wert liefern und gleichzeitig als Leuchtturmprojekte für die gesamte Organisation dienen. So wird Vertrauen aufgebaut und die Dynamik für nachfolgende, komplexere Wellen geschaffen.
Ein entscheidendes Werkzeug für diese Priorisierung ist die Daten-Wert-Matrix. Auf den beiden Achsen werden die „Datenverfügbarkeit & -qualität“ und das „Geschäftspotenzial“ abgetragen. Jede potenzielle Datenprodukt-Idee wird auf dieser Matrix positioniert. Der „Sweet Spot“ für die erste Welle liegt im oberen rechten Quadranten: Projekte mit hohem Geschäftspotenzial, für die bereits gute Daten vorhanden sind. Diese „Quick Wins“ sind der Schlüssel zum Erfolg.
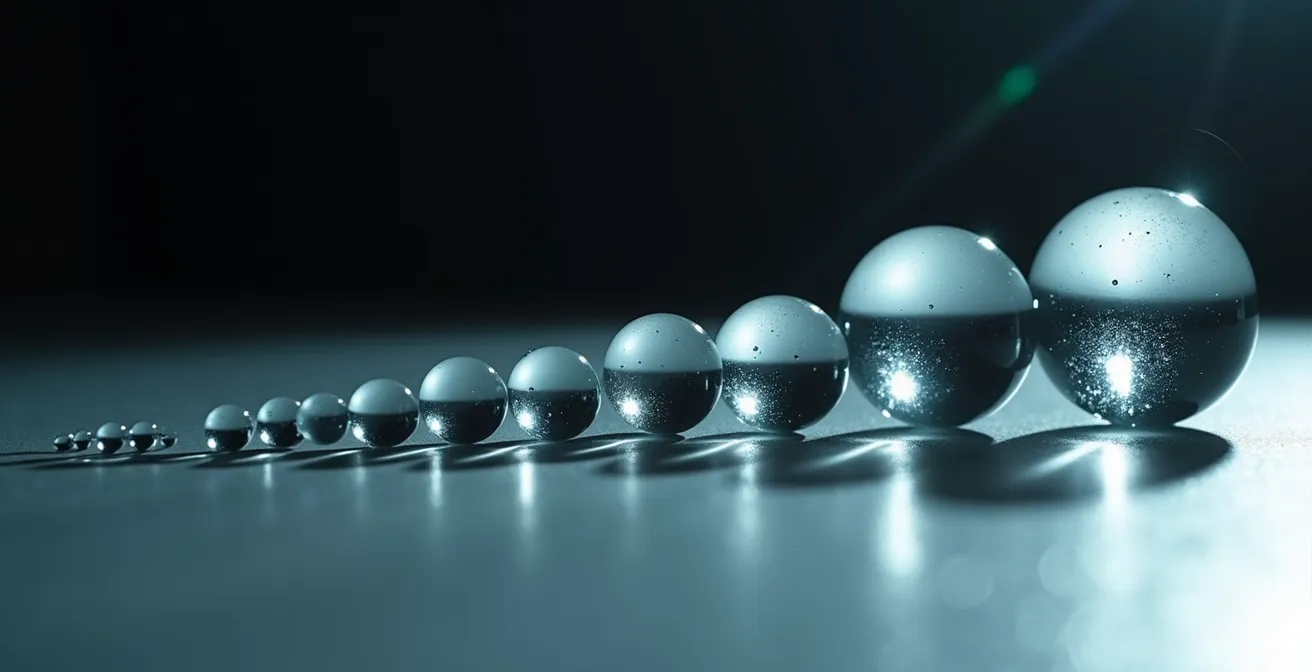
Die visuelle Darstellung in der Matrix macht die strategische Stossrichtung für alle Beteiligten sofort verständlich. Oft ist es klug, mit einem internen Effizienzprojekt wie Predictive Maintenance zu starten. Auch wenn dies primär Kosten spart, dient es als perfektes Vehikel, um die Organisation von der Macht der Daten zu überzeugen und die notwendigen Kompetenzen aufzubauen. Diese erste erfolgreiche Welle erzeugt die notwendige Prozess-Dividende und ebnet den Weg für die Monetarisierung nach aussen.
Um diesen Prozess zu strukturieren, folgen Sie einem klaren Plan:
- Schritt 1: Führen Sie eine umfassende Bestandsaufnahme Ihrer vorhandenen Daten und deren Qualität durch.
- Schritt 2: Bewerten Sie das Geschäftspotenzial jedes denkbaren Datenprodukts auf einer einheitlichen Skala.
- Schritt 3: Erstellen Sie die Daten-Wert-Matrix, indem Sie die Achsen „Datenverfügbarkeit“ und „Geschäftspotenzial“ nutzen.
- Schritt 4: Identifizieren Sie den Sweet Spot im oberen rechten Quadranten als Ziel für die erste Implementierungswelle.
- Schritt 5: Beginnen Sie idealerweise mit einem intern fokussierten Projekt (z.B. Predictive Maintenance), um schnell Vertrauen aufzubauen und die Methodik zu erproben, wie es eine Anleitung zur Entwicklung von Datenprodukten empfiehlt.
Durch diesen iterativen Ansatz wandelt sich die digitale Transformation von einer gefürchteten Revolution zu einer beherrschbaren und motivierenden Evolution.
Vollständige Cloud-Migration oder hybride Infrastruktur: was für Ihr Unternehmen passt?
Die Frage nach der richtigen IT-Infrastruktur ist keine rein technische, sondern eine zutiefst strategische Entscheidung. Eine vollständige Migration in die Public Cloud verspricht Skalierbarkeit und Flexibilität, wirft aber Fragen bezüglich Datensouveränität und Latenz auf. Eine hybride Infrastruktur, die Public-Cloud-Dienste mit einem eigenen Rechenzentrum (On-Premise) kombiniert, bietet mehr Kontrolle, kann aber komplexer im Betrieb sein. Für deutsche Unternehmen, die traditionell hohen Wert auf Datenschutz und Sicherheit legen, ist dies eine kritische Abwägung.
Die Entscheidung hängt stark vom Geschäftsmodell und den regulatorischen Anforderungen ab. Wie die Bundesnetzagentur betont, ist die Wahl kontextabhängig:
Für die ‚Industrie 4.0‘ ist oft ein Edge-/Hybrid-Ansatz für Echtzeit-Verarbeitung in der Fabrikhalle zwingend, während für den E-Commerce eine vollständige Cloud-Lösung sinnvoller sein kann.
– Bundesnetzagentur, Digitale Transformation Mittelstand
Ein hybrider Ansatz ist oft der pragmatische Königsweg für den deutschen Mittelstand. Er ermöglicht es, hochsensible Produktions- oder Kundendaten (Stichwort: DSGVO) sicher im eigenen Haus oder bei einem zertifizierten deutschen Anbieter zu verarbeiten, während weniger kritische Applikationen oder rechenintensive Analysen die Flexibilität der Public Cloud nutzen. Initiativen wie GAIA-X zielen genau darauf ab, eine souveräne europäische Dateninfrastruktur als Alternative zu den US-Hyperscalern zu etablieren.
Die Nutzung von Cloud-Diensten ist in Deutschland bereits weit verbreitet. Nach aktuellen Zahlen liegt der Anteil der Unternehmen, die Cloud-Services nutzen, bei 47 %. Der Trend geht klar in Richtung hybrider Modelle, die das Beste aus beiden Welten vereinen: die Sicherheit und Kontrolle der eigenen Infrastruktur mit der Agilität und Innovationskraft der Cloud.
Die richtige Infrastruktur ist somit kein Ziel an sich, sondern das Fundament, auf dem neue, datengetriebene Geschäftsmodelle sicher und performant aufgebaut werden können.
Der Technologie-Rollout, der Mitarbeiter zurücklässt und dadurch wertlos bleibt
Die beste Technologie ist wertlos, wenn sie nicht von den Mitarbeitern angenommen und genutzt wird. Ein rein Top-Down verordneter Technologie-Rollout ohne begleitendes Change-Management und gezielte Qualifizierung ist der sicherste Weg, um Millionen zu investieren und Frustration zu ernten. Insbesondere erfahrene Mitarbeiter, die sich seit Jahrzehnten auf ihre Intuition verlassen, sehen neue datengetriebene Werkzeuge oft als Bedrohung oder Misstrauensvotum. Der Mangel an qualifizierten Fachkräften verschärft dieses Problem zusätzlich.
Das Ausmass der Herausforderung ist immens. Eine Bitkom-Studie zeigt deutlich, dass für 74 % der Mittelständler der Fachkräftemangel die grösste Hürde bei der Digitalisierung darstellt. Es geht also nicht nur darum, neue Leute einzustellen, sondern vor allem darum, die bestehende Belegschaft mitzunehmen und zu befähigen. Die Investition in Menschen ist genauso wichtig wie die Investition in Software.
Ein herausragendes Erfolgsmodell zur Überwindung dieser Hürde ist das Konzept der „Daten-Lotsen“, wie es beispielsweise die ERGO Gruppe erfolgreich umgesetzt hat. Statt eine zentrale IT-Abteilung mit der alleinigen Verantwortung zu betrauen, wurden respektierte Fachexperten aus verschiedenen Abteilungen zu Daten-Champions ausgebildet. Diese Lotsen fungieren als Übersetzer und Brückenbauer: Sie verstehen die Sprache des Fachbereichs und können die technischen Möglichkeiten der Datenanalyse in konkreten Nutzen für ihre Kollegen übersetzen. Sie bauen Skepsis ab, indem sie kleine, aber wirkungsvolle Erfolgsgeschichten in ihrem eigenen Team schaffen.
Diese dezentrale Befähigung schafft eine Kultur, in der Daten nicht als Kontrollinstrument, sondern als wertvoller Erfahrungs-Verstärker wahrgenommen werden. Der Erfolg der digitalen Transformation wird nicht in der IT-Abteilung entschieden, sondern an der Werkbank, im Vertrieb und im Kundenservice – dort, wo die Daten entstehen und genutzt werden.
Wenn Mitarbeiter den Wert der neuen Werkzeuge für ihre tägliche Arbeit erkennen, wandelt sich Widerstand in proaktives Engagement und die Technologie entfaltet endlich ihr volles Potenzial.
Wann der Kipppunkt erreicht ist, an dem Modernisierung günstiger ist als Weiterbetrieb?
Das Festhalten an veralteten Legacy-Systemen fühlt sich oft wie der sicherere und günstigere Weg an. Doch diese Rechnung ist trügerisch. Sie ignoriert die explodierenden versteckten Kosten: steigende Wartungsaufwände für Systeme, deren Spezialisten bald in Rente gehen, wachsende Sicherheitsrisiken durch veraltete Technologie und vor allem die enormen Opportunitätskosten durch entgangene Umsätze. Der wahre Preis des Weiterbetriebs ist der Verzicht auf die Zukunft. Die Kipppunkt-Analyse ist ein strategisches Instrument, um diesen Moment objektiv zu bestimmen, an dem die Modernisierung nicht nur eine Option, sondern die wirtschaftlich einzig sinnvolle Entscheidung ist.

Diese Analyse geht weit über einen simplen Vergleich von Lizenzkosten hinaus. Sie muss die Total Cost of Ownership (TCO) des Altsystems den potenziellen Erträgen einer neuen, datengetriebenen Plattform gegenüberstellen. McKinsey-Studien belegen, dass durch datengetriebene Geschäftsmodelle EBITDA-Steigerungen von 15-25 % realisierbar sind. Diese potenziellen Gewinne sind die grössten Kosten des Festhaltens am Status quo.
Der Kipppunkt ist erreicht, wenn die Summe aus Wartungskosten, Sicherheitsrisiken und entgangenen Chancen die Investition in eine Modernisierung übersteigt. Ab diesem Moment subventioniert Ihr Unternehmen die Vergangenheit auf Kosten der Zukunft.
Ihr Fahrplan zur Ermittlung des Modernisierungs-Kipppunkts
- Wartungskosten für Altsysteme vollständig erfassen (inkl. externer Spezialisten und internem Know-how-Verlust).
- Sicherheitsrisiken monetär bewerten (potenzielle Kosten durch Ausfallzeiten, Datenverlust, Compliance-Strafen).
- Opportunitätskosten berechnen: Entgangene Umsätze durch fehlende Datenprodukte und Services quantifizieren.
- Marktrisiko bewerten: Die Wahrscheinlichkeit der Disruption durch datenbasierte Wettbewerber analysieren und beziffern.
- Steuerliche Vorteile einbeziehen: Abschreibungsmöglichkeiten für digitale Wirtschaftsgüter und Förderungen nutzen, wie es Experten für datengetriebene Geschäftsmodelle empfehlen.
Die Frage ist nicht, ob dieser Kipppunkt kommt, sondern ob Sie ihn rechtzeitig erkennen, um proaktiv zu handeln, anstatt von der Marktentwicklung überrollt zu werden.
Wie Sie eine digitale Business Unit gründen, ohne Ihre Organisation zu spalten?
Wenn radikale, datengetriebene Innovationen entstehen sollen, stossen sie im etablierten Kerngeschäft oft auf Widerstand. Die Gründung einer separaten digitalen Business Unit oder eines „Inkubators“ kann eine Lösung sein, um die notwendige Agilität und Geschwindigkeit zu ermöglichen. Doch dieser Schritt birgt die Gefahr, eine Zwei-Klassen-Gesellschaft zu schaffen und die neue Einheit vom Rest der Organisation zu isolieren. Das Ziel muss sein, einen geschützten Raum für Innovation zu schaffen, der aber gleichzeitig fest mit dem Mutterkonzern verbunden bleibt, um Synergien zu nutzen und die spätere Integration zu gewährleisten.
Wir haben also kein Erkenntnisproblem, sondern ein Umsetzungsproblem. Die digitale Transformation verlangt von uns, nicht nur bestehende Prozesse zu optimieren, sondern radikale Innovationen voranzutreiben.
– Prof. Dr. Walter Jochmann, Kienbaum Strategiegipfel der Familienunternehmen
Eine Abspaltung muss kein Bruch sein. Es gibt intelligente Modelle, die Agilität und Anbindung kombinieren. Ein im deutschen Mittelstand bewährtes Vorgehen ist die Gründung einer agilen Einheit in Form einer Projekt-GmbH mit eigener Gewinn- und Verlustrechnung (GuV). Dies schafft unternehmerische Verantwortung und klare KPIs, während die gesellschaftsrechtliche Anbindung an die Konzernmutter den Zugang zu Ressourcen, Kunden und Marktwissen sicherstellt.
Eine weitere, besonders für den deutschen Mittelstand attraktive Alternative zur reinen Inhouse-Gründung ist die Kooperation mit externen Forschungseinrichtungen. Partnerschaften, beispielsweise mit Fraunhofer-Instituten, bieten direkten Zugang zu Spitzenforschung, Talenten und staatlichen Fördermitteln. Dieses Modell minimiert das Gründungsrisiko erheblich und beschleunigt den Innovationsprozess, indem es externes Know-how gezielt in die Organisation holt, ohne die eigene Kultur zu überfordern. So wird die digitale Einheit nicht zum Fremdkörper, sondern zur strategischen Brücke in die Zukunft.
Letztendlich geht es darum, ein Schnellboot zu Wasser zu lassen, das wendig genug für neue Gewässer ist, aber über ein starkes Seil mit dem Mutterschiff verbunden bleibt.
Wie Sie Mitarbeiter von Datenanalyse überzeugen, die seit 20 Jahren auf Erfahrung setzen?
Die grösste Hürde für eine datengetriebene Kultur ist oft nicht die Technologie, sondern die Skepsis erfahrener Mitarbeiter. Ihr über Jahre aufgebautes Erfahrungswissen ist ein unschätzbarer Wert für das Unternehmen. Wenn Datenanalyse als Angriff auf diese Intuition wahrgenommen wird, ist Widerstand vorprogrammiert. Der Schlüssel zur Überzeugung liegt darin, Daten nicht als Ersatz, sondern als Verstärker der Erfahrung zu positionieren. Es geht darum, das Bauchgefühl mit Fakten zu untermauern und bessere, schnellere Entscheidungen zu ermöglichen.
Dieser Wandel erfordert eine gezielte „Übersetzungs-Strategie“. Anstatt mit technischen Begriffen wie p-Werten oder Algorithmen zu argumentieren, muss der Nutzen in der Sprache des jeweiligen Fachbereichs kommuniziert werden. Zeigen Sie dem Produktioner, wie Daten die Ausschussquote senken, und dem Vertriebler, wie sie helfen, die vielversprechendsten Leads zu identifizieren. Der Fokus muss immer auf der Lösung eines konkreten, langjährigen Problems liegen.
JEMAKO erzielte wichtige Fortschritte in der Organisationsentwicklung durch erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem Mittelstand-Digital Zentrum. Durch gezielte Schulungen wurden langjährige Mitarbeiter zu ‚Daten-Champions‘, die ihre Erfahrung mit neuen Analytics-Tools kombinierten. Das Ergebnis: Verbesserte Prozesse bei gleichzeitiger Wertschätzung des Erfahrungswissens.
– Erfolgreiche Transformation im deutschen Maschinenbau, Mittelstand-Digital Zentrum Ruhr-OWL
Die praktische Umsetzung dieser Übersetzungs-Strategie kann anhand folgender Punkte erfolgen:
- Sprechen Sie nicht über ‚p-Werte‘, sondern über ‚geringere Ausschussquoten‘.
- Positionieren Sie Daten als ‚Erfahrungs-Verstärker‘, nicht als Ersatz für Intuition.
- Beginnen Sie mit deskriptiver Analyse (‚Was ist passiert?‘), um Vertrauen aufzubauen, bevor Sie zu prädiktiven Modellen übergehen.
- Nutzen Sie intuitive, visuelle Dashboards statt komplexer Excel-Tabellen.
- Lassen Sie erfahrene Mitarbeiter kleine Pilotprojekte leiten, die mit Datenunterstützung ein von ihnen lange erkanntes Problem lösen.
Wenn erfahrene Mitarbeiter erkennen, dass Daten ihre Expertise nicht entwerten, sondern aufwerten, werden sie von den grössten Skeptikern zu den stärksten Befürwortern.
Das Wichtigste in Kürze
- Verschieben Sie den Fokus von reiner Kostensenkung (Prozessdigitalisierung) hin zur Schaffung neuer Erlösströme (Geschäftsdigitalisierung).
- Priorisieren Sie Ihre Digitalisierungsprojekte mit einer Daten-Wert-Matrix, um mit schnellen Erfolgen Vertrauen und Momentum aufzubauen.
- Machen Sie Ihre Mitarbeiter zu „Daten-Lotsen“ und positionieren Sie Datenanalyse als Verstärker für Erfahrungswissen, nicht als dessen Ersatz.
Wie Sie Wert neu definieren, wenn Ihr physisches Produkt austauschbar wird
In einer globalisierten Welt, in der physische Produkte immer stärker vergleichbar und austauschbar werden, liegt der Schlüssel zur Differenzierung und zu höheren Margen nicht mehr im Produkt selbst, sondern in den damit verbundenen Dienstleistungen. Für traditionelle Hersteller, insbesondere im deutschen Maschinen- und Anlagenbau, bedeutet dies einen fundamentalen strategischen Wandel: den Wertschöpfungs-Pivot vom reinen Produktverkäufer zum Lösungsanbieter. Die Daten, die von vernetzten Produkten im Feld generiert werden, sind der Rohstoff für diese neuen, hochprofitablen Geschäftsmodelle.
Das Konzept „X-as-a-Service“ (XaaS) ist die konsequente Umsetzung dieser Logik. Statt eine Maschine zu verkaufen, wird deren Ergebnis oder Verfügbarkeit als Dienstleistung verkauft. Deutsche Werkzeugmaschinenhersteller verkaufen nicht mehr nur die Maschine, sondern „garantierte Maschinenverfügbarkeit als Service“ (Uptime-as-a-Service). Kunden zahlen nur für die tatsächliche Nutzung oder die produzierte Stückzahl. Der Hersteller nutzt Sensordaten und Predictive Maintenance, um die vernetzten Produkte optimal zu warten, Ausfälle zu vermeiden und seine Marge zu sichern.
Dieses Modell transformiert die Kundenbeziehung von einer transaktionalen zu einer partnerschaftlichen. Der Hersteller hat ein ureigenes Interesse daran, dass sein Produkt beim Kunden maximal performt. Diese Transformation ist besonders relevant für den starken Kern der deutschen Wirtschaft. Von den rund 800 deutschen Unternehmen mit über 1 Milliarde Euro Umsatz sind 80 % Familienunternehmen, viele davon im produzierenden Gewerbe. Für sie ist die Neudefinition von Wert über Daten-Services der entscheidende Hebel, um ihre Marktführerschaft auch im digitalen Zeitalter zu behaupten.
Der Wert liegt nicht mehr im Stahl, sondern in der intelligenten Analyse der Daten, die dieser Stahl erzeugt. Es ist die Transformation vom Verkauf eines Bohrers zum Verkauf von „garantierten Löchern pro Stunde“.
Beginnen Sie noch heute damit, Ihre Daten-Assets zu bewerten und den ersten Schritt zur Monetarisierung zu planen. Definieren Sie den Wert Ihres Unternehmens neu, bevor es der Wettbewerb für Sie tut.
Häufig gestellte Fragen zur Erschliessung datenbasierter Geschäftsmodelle
Wie kann ich DSGVO-Konformität bei Cloud-Lösungen sicherstellen?
Ein hybrides Modell ermöglicht es, sensible Kundendaten On-Premise in Deutschland zu halten, während die Public Cloud für nicht-sensitive Rechenlasten genutzt wird. Dies bietet einen guten Kompromiss aus Flexibilität und Datenschutz.
Was ist GAIA-X und welche Vorteile bietet es?
GAIA-X ist eine europäische Initiative zur Schaffung einer sicheren und vertrauenswürdigen Dateninfrastruktur. Sie zielt darauf ab, die Datensouveränität zu stärken und eine Alternative zu den US-Hyperscalern zu bieten, die speziell auf die regulatorischen und wirtschaftlichen Anforderungen deutscher und europäischer Unternehmen zugeschnitten ist.
Welche Kriterien sind für die Entscheidung Cloud vs. Hybrid entscheidend?
Die Hauptkriterien für Ihre Entscheidung sind: die Art und Sensibilität der verarbeiteten Daten (z.B. personenbezogene Daten, Produktionsgeheimnisse), die Anforderungen an die Latenz (Verarbeitungsgeschwindigkeit), spezifische regulatorische Vorgaben Ihrer Branche und der Zustand Ihrer bestehenden IT-Infrastruktur.